
„Man kehrt nie aus Auschwitz zurück.“
Zerbrechlich sieht sie aus, die kleine alte Dame, die am Küchentisch ihrer Wohnung im Pariser Viertel Saint-Germain-des-Prés sitzt. Sie blättert in einem Stapel von Dokumenten, Fotos und Briefen, sinnt nach und erzählt von 90 Jahren Leben. Es strengt sie an, sich zu erinnern, und erst jetzt, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, kann sie die dunkelsten Kapitel ihres Lebensweges in Worte fassen. Ihre feuerrot gefärbten Locken leuchten, und an den schmalen Händen funkeln überdimensionale, bunte Ringe.
Im Flur aufgereiht stehen ihre Schuhe. Es sind die Schuhe eines Kindes, Größe 33. Denn sie hat aufgehört zu wachsen, als sie mit knapp 16 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurde.
Als Marceline Rosenberg wird sie am 19. März 1928 im französischen Épinal in den Vogesen geboren.

Ihr jüdischer Vater ist 1919 aus Polen nach Frankreich eingewandert und gründet hier eine Familie, mit der er sich später in der Kleinstadt Bollène in der Provence niederlässt. Als Betriebsleiter einer Strickwarenfabrik verfügt er über die finanziellen Mittel, um für die wachsende Familie ein kleines Schloss kaufen zu können. Dort wächst Marceline mit zwei Schwestern und zwei Brüdern auf.
Auf die scheinbar unbeschwerten Kinderjahre fallen bald die Schatten des Zweiten Weltkriegs. Frankreich wird vom deutschen NS-Regime besetzt, und antisemitische Tendenzen greifen immer bedrohlicher um sich. Südfrankreich gehört zwar zunächst noch zur „Freien Zone“, doch auch dort werden schon bald Juden verfolgt und deportiert.
Als schließlich 1942 das gesamte Land in deutscher Hand ist, bleibt auch die Familie Rosenberg nicht verschont. SS-Leute beschlagnahmen das Schloss, Marceline wird gemeinsam mit ihrem Vater zunächst in Avignon und Marseille inhaftiert und anschließend mit dem Transport 71 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ihr Vater kehrt nie aus Auschwitz zurück und wird 1948 von der französischen Regierung für tot erklärt. Marceline überlebt Birkenau.
Erst 70 Jahre später ist sie in der Lage, das erlebte Grauen in den Konzentrationslagern zu schildern. 2015 erscheint ihre Erzählung Und du bist nicht zurückgekommen, in der sie schonungslos ihr Leid im Vernichtungslager Birkenau und die Qualen auf dem anschließenden Todesmarsch über das KZ Bergen-Belsen bis zum Ghetto Theresienstadt beschreibt, das im Mai 1945 befreit wird.

Bereits auf dem Transport nach Polen sagt Marcelines Vater zu ihr: „Du wirst vielleicht zurückkommen, weil du jung bist, aber ich werde nicht zurückkommen.“ In den Lagern trennen die beiden nur drei Kilometer, doch diese scheinen unüberwindlich. „Zwischen uns waren Felder, Blocks, Wachttürme, Stacheldrähte, Krematorien und über allem die unerträgliche Ungewissheit, was aus dem anderen wurde.“
Ihrem Vater gelingt es, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen; es sind vier oder fünf Sätze auf einem schmutzigen Blatt Papier, die sie begierig liest, die sie aber nicht im Gedächtnis behalten kann. Auch den Zettel findet sie später nicht wieder. Marceline erinnert sich nur an die Anrede „Mein liebes kleines Mädchen“ und die Unterschrift mit seinem jüdischen Vornamen „Schloime“. Sie ist bereits zu entkräftet, zu erloschen, um aus Botschaft ihres Vaters Trost schöpfen zu können. „Dein Brief kam zu spät. Wahrscheinlich sprach er mir von Hoffnung und Liebe, aber es war keine Menschlichkeit mehr in mir“, schreibt sie in ihren Erinnerungen, „ich grub direkt neben den Gaskammern (…) ich stand im Dienst des Todes.“ Es dauert sieben Jahrzehnte, bis sie auf die Nachricht ihres Vaters antworten kann. Ihr Buch ist ein Brief an ihn.
Krank, abgemagert und schwer traumatisiert kehrt Marceline als siebzehnjähriges Mädchen in ihre Heimat zurück. Beim Anblick von Zügen und Fabrikschloten beginnt sie zu zittern, sie kann lange kein Badezimmer mit Dusche betreten und schläft nachts auf dem Boden, weil sie die Bequemlichkeit eines Bettes nicht erträgt. Von ihrer Mutter und den Geschwistern, aber auch vom Umfeld der Familie fühlt sie sich unverstanden. In der französischen Nachkriegsgesellschaft und vor allem in der überlebenden jüdischen Bevölkerung herrscht ein fast gewaltsames Streben nach „Normalität“ und Neuaufbau. Man will die erlittenen Qualen vergessen. Wer aus den Lagern zurückkehrt, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Marcelines Onkel, der ebenfalls interniert war, warnt sie: „Erzähl ihnen nichts, sie verstehen es nicht.“ Um so schmerzlicher vermisst das Mädchen ihren Vater. Wäre er noch am Leben, er würde sie verstehen. „Wir wären zwei gewesen, die wussten.“
Trotz oder gerade wegen der verzweifelten Verdrängungsversuche zerbricht Marcelines Familie an ihrem Schicksal. Ihre Mutter, die keine Gefühle zeigen kann, bleibt ihr fremd; zwei ihrer Geschwister werden psychisch krank und nehmen sich später das Leben. „Sie hatten die Lagerkrankheit, ohne je dort gewesen zu sein“, schreibt Marceline später.
Im Lager hat sie mit allen Kräften ums Überleben gekämpft, doch als das Grauen überstanden ist, ist sie zunächst “ unfähig zu leben“. Ohne ihren Vater findet sie keinen Weg, mit der neuen Freiheit umzugehen. „Es war wie ein blendendes Licht nach Monaten im Dunkeln, es war gewaltsam.“

Nur langsam erwacht die Lebenskraft der traumatisierten jungen Frau wieder. Einige Jahre nach dem Krieg zieht sie nach Paris und sucht in der Café- und Künstlerszene von Saint-Germain-des-Prés nach Inspiration. Sie sehnt sich nach „Unbeschwertheit und Bekanntschaft“. Nach etlichen eher wahllos ausgeübten Jobs landet sie zufällig beim Film und bekommt kleine Rollen in wenig bekannten Produktionen.
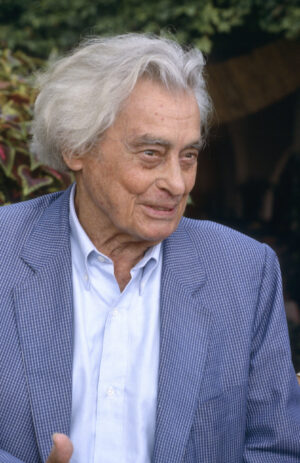
Ihre erste Ehe mit dem Ingenieur François Loridan geht rasch wieder auseinander, als ihr Mann eine Stellung im Ausland annimmt, Marceline aber Paris nicht verlassen will. Anfang der 1960er Jahre lernt sie dann ihren zweiten Mann Joris Ivens kennen, mit dem sie bis zu seinem Tod 1989 zusammenlebt. Der Niederländer ist ein bekannter Dokumentarfilmer, auf der ganzen Welt zu Hause, und er ist dreißig Jahre älter als Marceline. Sie begleitet ihn nun auf seinen Reisen, arbeitet mit ihm an Filmproduktionen und teilt seinen Idealismus. Sie ist zwar nach dem Krieg „nicht optimistisch geworden“, glaubt aber trotzdem, dass die Welt zum Besseren verändert werden kann. Gemeinsam drehen sie über den Vietnamkrieg, den Aufstand in Algerien und die chinesische Kulturrevolution, die sie – naiv wie manche in diesen Jahren – trotz der abschreckenden Erfahrungen mit dem russischen Kommunismus für eine Chance auf ein gerechteres menschliches Miteinander halten.
1988 erscheint ihr gemeinsamer, mehrfach preisgekrönte Dukumentarfilm Eine Geschichte über den Wind, der ebenfalls teilweise in China gedreht wurde und in poetischen Bildern die Schönheit, aber auch die zerstörerische Kraft des Elements Luft einfängt und die Beziehung zwischen Mensch und Natur thematisiert.

Marceline lernt erst allmählich, sich gegenüber dem erfahrenen und tonangebenden Joris zu behaupten und eigene Filmprojekte zu verwirklichen. Nach Joris‘ Tod wird sie 1991 eingeladen, Eine Geschichte über den Wind auf dem Warschauer Filmfestival zu präsentieren. Obwohl sie Polen eigentlich nie wieder betreten wollte, reist sie nach Warschau und besucht anschließend die Gedenkstätte des Lagers Auschwitz-Birkenau. Ihre Erinnerungen an den geliebten Vater, aber auch die dort erlebten Schrecken steigen wieder in ihr auf. „Der Geruch, die Schreie, die Hunde, (…) der vor lauter Flammen rot-schwarze Himmel“, all dies durchlebt sie nach Jahrzehnten erneut.
Mehr als zehn Jahre später, Marceline ist inzwischen 74 Jahre alt, dreht sie den Film Birkenau und Rosenfeld, der in fiktiver Form die brutalen Erlebnisse ihrer Jugendzeit und das Leid ihrer Familie aufgreift. Es ist der erste Spielfilm überhaupt, der auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau gedreht werden darf.
Marceline trifft in Paris regelmäßig jüdische Holocaust-Überlebende und teilt ihre Erfahrungen mit ihnen. Sie will jüdische Kultur lebendig erhalten und reist mehrfach nach Israel, das Sehnsuchtsland ihres Vaters. Dort fühlt sie sich zwar wohl, aber „es ist nicht das Land des Friedens, das wir erstrebten.“
Sie bleibt aktiv bis ins hohe Alter, plant weitere Filmprojekte, schreibt mehrere Bücher, unternimmt Reisen. „Man muss arbeiten. Immer.“ Denn „natürlich kann man sich zum Tod hin treiben lassen. Aber man kann auch ins Leben gehen, solange man kann, (…) Es gibt keine andere Option als die Lebenskraft in uns.“
War es gut, aus dem Lager ins Leben zurückzukehren? Diese Frage stellt sie sich immer wieder. In dunklen Momenten zweifelt sie manchmal daran. Dennoch hofft sie, dass sie „kurz bevor ich abtrete, (…) werde sagen können, ja, es hat sich gelohnt.“
Am 18. September 2018, kurz nachdem der Dokumentarfilm Marceline. Eine Frau. Ein Jahrhundert über ihr bemerkenswertes Leben erschienen ist, stirbt Marceline im Alter von 90 Jahren in ihrer Wohnung in St-Germain-des-Prés. Bei ihrer Bestattung auf dem Friedhof Montparnasse weht, so ist es überliefert, ein lebhafter Wind.

